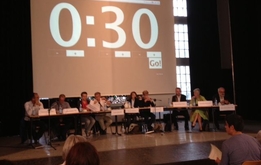Von Andrea Seibel und Richard Herzinger
Das grüne Ehepaar Marieluise Beck und Ralf Fücks ist sich einig, dass die Ukraine und der Umgang mit Putin zum Lackmustest des freiheitlichen Europa werden. Der Traum von 1989 ist geplatzt
Sie sind seit über 30 Jahren ein Paar, auch ein politisches. Marieluise Beck (61) ist die dienstälteste Grüne im Bundestag, Ralf Fücks (62) im Vorstand der grünen Heinrich-Böll-Stiftung. Sie haben zwei Kinder, "nur", sagt Frau Beck. Denn sie kommt aus einer kinderreichen Familie. Er war Einzelkind von Arbeitern in Edenkoben, die ein arisiertes Haus erwarben und nach dem Krieg ein Schuhgeschäft aufmachten. Dass er dem antiautoritären Ruf folgte, wundert nicht.
Sie studierte in Heidelberg und lebte in einer Polit-WG. Sie wollte aber bürgerlich sein, eine Wohnung mit Gardinen haben und heiraten. Also schlich sie sich davon. Er musste erst Koestler lesen, um sich von dem ganzen Müll zu befreien: "Jogi und der Kommissar". Beide fühlen sich unabhängig und frei und haben viel Humor: Solitäre im grünen Milieu.
Die Welt: Sie beide sind viel auf Reisen. Sie, Frau Beck, waren jüngst in Bosnien, Sie, Herr Fücks, in den USA. Was bringen Sie mit?
Ralf Fücks: Ich war in Washington. Dort drehten sich viele Gespräche um die deutsche Politik gegenüber der Ukraine und Russland. Es gibt Irritationen über die Umfragen, nach denen sich eine Mehrheit der Deutschen eher eine Position der Neutralität wünscht. Umgekehrt sehen wir auch in Amerika eine Stimmung des Rückzugs. Das ist ein Reflex auf die blutige Nase, die man sich im Irak geholt hat. Afghanistan wird auch nicht wirklich als Erfolg angesehen, in Libyen droht Chaos. Es gibt in den USA Selbstzweifel und Vorbehalte gegen militärische Interventionen. Das Land stößt an seine politischen und finanziellen Grenzen. Was das für uns bedeutet, wurde hier noch gar nicht erfasst.
Aber was spricht dagegen, sich bei brisanten Konflikten zurückzuhalten oder gar aus ihnen herauszuhalten?
Fücks: Wir können versuchen, die Konflikte in der Welt zu ignorieren, aber sie ignorieren uns nicht. Das gilt umso mehr, wenn sie sich in unserer östlichen Nachbarschaft oder in der arabischen Welt abspielen. Dabei geht es nicht nur um unmittelbare Sicherheitsinteressen. Es geht um die Frage der internationalen Ordnung. Also: Fallen wir in eine Zeit von Gewalt und Chaos zurück, in der das Recht des Stärkeren gilt, oder gelingt es, Demokratie und Völkerrecht als Ordnungsprinzipien zu behaupten und damit auch ein friedliches und kooperatives Umfeld für Europa?
Marieluise Beck: Ich habe derzeit eine Art historisches Déjà-vu. Mir kommt die passive Haltung des Westens gegenüber Russland vor wie die vor zwanzig Jahren gegenüber der serbischen Aggression in Bosnien. Auch damals waren wir nicht in der Lage, die Entwicklung zu antizipieren, und weigerten uns zu lange, unangenehmen Wahrheiten ins Auge zu sehen. In Bosnien sagen die Bürgerinnen und Bürger noch heute: Wir können nicht verstehen, wie dieser Krieg überhaupt ausbrechen konnte. Wir haben doch als Nachbarn gut und friedlich zusammengelebt. Woher kam plötzlich dieser ethnische Hass? Wie damals in Bosnien wird er auch heute in der Ukraine von außen gewaltsam in das Land hineingetragen. Damals durch serbische, heute durch russische Paramilitärs.
Hat uns Russland aber nicht noch mehr überrumpelt als damals Serbien? Man hielt Russland im Westen doch für einen "strategischen Partner". Außerdem gibt es für Putin, anders als damals für Milosevic, hierzulande viel ausdrückliche Sympathie.
Beck: Es gab schon auch eine gewisse Sympathie mit Milosevic. Linke Sozialdemokraten zum Beispiel hatten große Sympathien für die jugoslawischen Kommunisten und wollten nicht wahrhaben, dass aus dem ehemaligen KP-Mann Milosevic ein völkischer Nationalist geworden war. Andere Intellektuelle ergriffen Partei für Serbien aufgrund der Verbrechen der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg. Demselben Reflex begegnet man heute, wenn es heißt: Wer Putin kritisiert, ist ein Kalter Krieger. Dabei ist die Rückkehr zur Konfrontation Schritt für Schritt von Putin betrieben worden. Es fing an mit der autoritären Wende in der russischen Innenpolitik. Zuerst wurde in die Enge gedrängt, wer die Aufarbeitung des Stalinismus betrieb, denn die war nicht gewollt. Ganz im Gegenteil: die russische Machtelite verbreitet den Mythos, Stalin habe sich doch nur gegen eine Welt von Feinden zu Wehr gesetzt. Auf dieser Linie wird jetzt eine faschistische Bedrohung in der Ukraine suggeriert. So kann die Aggression gegen die Ukraine als Fortsetzung des Großen Vaterländischen Kriegs hingestellt werden, was der russischen Bevölkerung von morgens bis abends eingeimpft wird.
Nicht allzu viele in Deutschland sehen das so eindeutig wie Sie. Es wirkt da zum Beispiel ein selektiver deutscher Antifaschismus, der besagt, wir müssten uns gegenüber Putin zurückhalten, weil Deutschland vor 70 Jahren Russland überfallen hat. Dabei hat Deutschland ja …
Fücks: ... die Sowjetunion überfallen. Offenbar wird die berechtigte historische Befangenheit gegenüber Russland nicht gegenüber der Ukraine empfunden. Mancher große Geist hat ja sogar die Legende übernommen, die Ukraine sei bloß ein künstliches Gebilde. Es spielt hier eine besondere Russland-Faszination hinein, die tief in der deutschen Kultur- und Politikgeschichte verankert ist: Die Vorstellung einer deutsch-russischen Seelenverwandtschaft, die sich in der gemeinsamen Ablehnung der kapitalistische Moderne trifft.
Beck: Wer weiß bei uns schon über das millionenfache Aushungern der Bauern in der Ukraine Anfang der 30er-Jahre Bescheid, wer kennt den Hitler-Stalin-Pakt von 1939, wer hat im Kopf, dass Polen am 1. September 39 von Deutschland, am 17. September von der Roten Armee überfallen wurde? Wegen der deutschen Schuld haben wir nur einen Teil der Geschichte aufgearbeitet.
Von vielen Lesern werden wir Journalisten mit der Forderung bestürmt, endlich mit der dauernden Putin-Kritik aufzuhören, weil das einen Krieg auslösen könnte.
Fücks: Wir können nicht aus Furcht die Augen davor verschließen, dass Russland militärische Gewalt gegenüber der Ukraine einsetzt und internationale Verträge mit Füßen tritt. Was mich an der deutschen Debatte sehr irritiert, ist der Mangel an Empathie mit der Ukraine als einem Land, das sich auf den Weg nach Europa gemacht hat. Weshalb wollen so viele nicht wahrhaben, dass dort ein großer demokratischer Aufbruch begonnen hat – trotz der hässlichen Elemente, die jede Revolution mit nach oben spült? Einen vergleichbaren Mangel an Empathie gab es auch schon gegenüber der "Solidarnosc" in den Achtzigerjahren.
Im Europawahlkampf haben auch die Grünen eher die Bedrohung durch das Chlor-Hähnchen herausgestellt als die von Freiheit und Frieden durch Putins Autoritarismus.
Beck: Wenn eine Partei eine klare Haltung im Ukraine-Konflikt hat, dann sind es die Grünen. Das gilt auch für unsere Solidarität mit der russischen Bürgerbewegung. Ich will aber auf etwas anderes hinaus: In der damaligen Auseinandersetzung um eine Intervention in Bosnien hat der Schriftsteller Peter Schneider eine wichtige Frage aufgeworfen: Wenn die Postachtundsechziger den Pazifismus als ethisch einzig vertretbare Konsequenz aus dem Nationalsozialismus hinstellen, delegitimieren sie damit nicht den Kampf der Alliierten gegen die deutsche Aggression und stellen sich indirekt auf die Seite ihrer Täter-Väter? Für mich schwingt diese Frage heute immer mit, wenn ich die weitverbreitete heftige Ablehnung von Nato und USA betrachte. Wir haben großes Verständnis für die Gewaltpolitik Putins, aber sind sehr schnell bei der Hand, wenn es gegen den "amerikanischen Imperialismus" geht. Dieser Affekt gegen die USA findet sich in einem breiten Spektrum von Lafontaine bis Gauweiler.
Wie erklären Sie sich, dass dieser antiwestliche Affekt inzwischen die Mitte erreicht hat und nicht mehr nur bei Links- und Rechtsradikalen grassiert – die sich in der Solidarität mit Putin verblüffend einig sind.
Beck: Tendenziell war dieser Anti-Affekt schon immer da. Wir leben im Alltag hervorragend mit diesem marktwirtschaftlichen System, aber es gibt dennoch tief sitzende Aversionen. Nicht umsonst konnte die NS-Ideologie am Sozialismusbegriff ansetzen und ihn mit Ressentiments gegen den angelsächsischen Kapitalismus und vor allem gegen die Juden anfüllen. Das Ressentiment gegen das internationale Finanzkapital, die Plutokratie, Wall Street – alle dies ist in unserer Gesellschaft noch präsent.
Der Historiker Heinrich August Winkler hat vor einigen Jahren das Buch "Der lange Weg nach Westen" veröffentlicht. Er hielt diesen Weg für abgeschlossen. War er zu voreilig?
Beck: Ja, ich glaube schon, denn die langen Linien unguter deutscher Geschichte reichen weiter, als wir dachten.
Fücks: Das ist doch zwiespältiger. Tatsächlich ist Deutschland heute kulturell sehr viel "westlicher", offener, pluralistischer, freier als je zuvor in seiner Geschichte. Die USA werden dämonisiert, gleichzeitig importieren wir ständig die neuesten Trends von dort – von der Genderdebatte bis zu Facebook und Twitter. Umgekehrt halten die meisten Deutschen bei aller Russland-Sentimentalität den Kreml nicht für eine vertrauenswürdige Macht.
Manchmal wird Ihnen vorgeworfen, aus menschenrechtlichem Moralismus Konflikte wie den in der Ukraine zu schwarz-weiß zu malen.
Fücks: Es geht uns nicht darum, eine Seite zu idealisieren. Die Ukraine hat einen Haufen Probleme, von einer korrumpierten politischen Elite bis zur Macht der Oligarchen. Aber kritisch zu sein heißt nicht, neutral zu sein, wenn ein Land genau dann attackiert wird, da es begonnen hat, sich neu zu erfinden.
Es ist aber doch offensichtlich, warum viele nicht Partei ergreifen wollen: Aus Furcht vor einer kriegerischen Konfrontation mit Russland.
Fücks: Diese Furcht ist ja nicht unbegründet. Nachdem sich die Vorstellung einer Modernisierungspartnerschaft als Illusion entpuppt hat, müssen wir die Frage beantworten: Wie definieren wir künftig das Verhältnis von begrenztem Konflikt und begrenzter Kooperation? Ausweichen ermutigt Russland, seinen imperialen Kurs fortzusetzen.
Indessen ist der Militäretat der USA abgesunken. Sind unsere westlichen Demokratien vielleicht schon zu schwach, um sich einem Machtwillen wie dem Putins entgegenzustellen?
Beck: Wir leben in einer "postheroischen" Gesellschaft, die den Krieg scheut und darauf setzt, dass alle Konflikte durch Dialog und Kompromiss gelöst werden können. Das gilt insbesondere für Deutschland. Denken Sie an das wachsende Unverständnis für Israel – dass israelische Bürgerinnen und Bürger sagen: Wir sind bereit, uns gegen unsere Feinde, die uns vernichten wollen, zur Wehr zu setzen. Das Problem ist, dass die russische Führung nicht nach unserer Logik der Konfliktvermeidung handelt. Sie ist bereit, Gewalt einzusetzen, und rechnet damit, dass der Westen ihr nicht ernsthaft entgegentreten wird. Darauf sind wir nicht vorbereitet.
Fücks: Die deutsche Politik hat darauf gesetzt, dass 1989/90 ein neues Zeitalter der Demokratie und des Friedens begonnen hat. Inzwischen ist dieser Traum geplatzt. Statt einer Globalisierung der Demokratie entwickeln sich die Verhältnisse eher zurück in Richtung Autoritarismus und militärische Machtpolitik. Wir sind in einer neuen Systemkonkurrenz zwischen demokratischen Gesellschaften und autoritären Regimes. Die Ukraine-Krise ist auch ein Test auf die Selbstbehauptung der EU als politisches Projekt: Sind wir bereit, für die europäischen Werte einzutreten, wenn es ungemütlich wird? Es wäre ein historischer Fehler, wenn wir auf den Erfolg antieuropäischer Strömungen bei der Europawahl mit Anpassung antworten würden, statt die politische Einigung Europas entschieden voranzutreiben – gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik und einer gemeinsamen Energiepolitik. Die Frage ist, ob wir den dafür nötigen Gestaltungswillen noch aufbringen.
Beck: Das hat auch etwas mit dem Leiden an der Demokratie und der eigenen Verfasstheit zu tun. Viele unserer osteuropäischen Freunde schauen da etwas verständnislos drein und sagen: Eure Probleme hätten wir gerne. Während bei uns immer mehr Leute sagen: Die da oben sind ja sowieso alle korrupt, was sollen wir da abstimmen …
… und damit Extremisten das Feld überlassen. Während die so lange des "Faschismus" verdächtigten Ukrainer die rechtsradikalen Kandidaten mit zusammengenommen weniger als zwei Prozent der Stimmen in die Bedeutungslosigkeit geschickt haben.
Fücks: Das verweist auf ein tiefer liegendes Problem: dass uns die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Demokratie und Autoritarismus abhandenkommt. In vielen Debatten über die Ukraine begegnet man dem Argument, die USA seien doch noch schlimmer als Putin-Russland. Der Punkt ist, zwischen einer Demokratie, die natürlich auch Fehler macht, und einem autoritären Herrschaftssystem differenzieren zu können.
Warum also sind die Grünen nicht mit dem zentralen Thema der Verteidigung von Freiheit und Frieden in Europa in den Wahlkampf gezogen? Sind Sie so isoliert bei den Grünen?
Beck: Isoliert würde ich auf keinen Fall sagen. Aber man kann nicht wegdiskutieren, dass der Gründungskonsens der Grünen ursprünglich ein anderer gewesen ist. 1983 hatten wir ein Programm, in dem die Auflösung der Nato gefordert wurde. Diejenigen, die heute noch eine ablehnende Haltung gegenüber der Nato einfordern, können sich auf diese ursprüngliche Geschäftsgrundlage berufen. Die Grünen stehen auch unter dem Druck der Linkspartei, die antiwestliche Einstellungen revitalisiert.
Fücks: Wichtig ist, aus welcher Haltung heraus man die Überwachungsmethoden der NSA oder die Verhandlung über das Freihandelsabkommen kritisiert: ob mit der Absicht, die gemeinsamen Werte zu verteidigen oder die transatlantische Allianz aufzukündigen.
Sie beide sind gemeinsam auch einen langen Weg gegangen. Was verbindet Sie denn als ein politisches und intellektuelles Paar?
Beck: Also, ich glaube, es ist der Versuch, mit verbindlichen Werten, aber ohne Ideologie zu leben.
Fücks: Wir ziehen einen Gutteil unsres Engagements aus der deutsch-europäischen Geschichte des letzten Jahrhunderts. Daher rührt ein starkes antitotalitäres Motiv, das uns verbindet. Um Hannah Arendt zu zitieren: Freiheit als Sinn der Politik. Bei mir, der ich einmal einer K-Gruppe angehörte, kommt dieser Impuls auch aus den Brüchen in der eigenen Biografie. Außerdem erleben wir viel. Uns geht der Stoff nicht aus für das Gespräch, das wir miteinander führen.
Quelle: http://m.welt.de/print/die_welt/politik/article128873706/Wir-verlernen-was-eine-Demokratie-ist.html